- de
- en
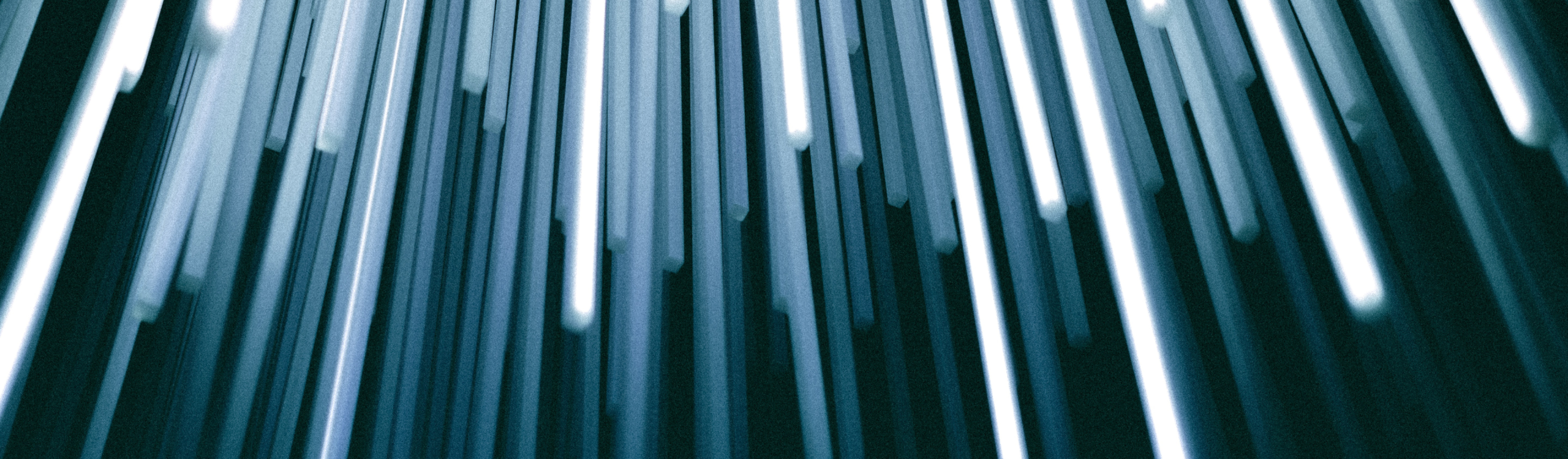
Bei den definierten Berufsbeschreibungen hat sich die Arbeitsgruppe bewusst national und international orientiert. Dabei lieferten uns etliche Standards und eidg. anerkannte Prüfungsabschlüsse bzw. internationale Zertifikate die Vorgaben für die Berufsbeschreibungen. Nicht berücksichtigt sind proprietäre Modelle und Projektmanagement-Methoden.
Es wurden ausschliesslich Frameworks, Standards und Abschlüsse einbezogen, die anerkannt sind oder als etablierte Best Practices gelten.